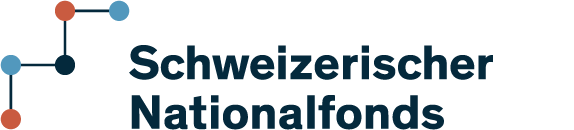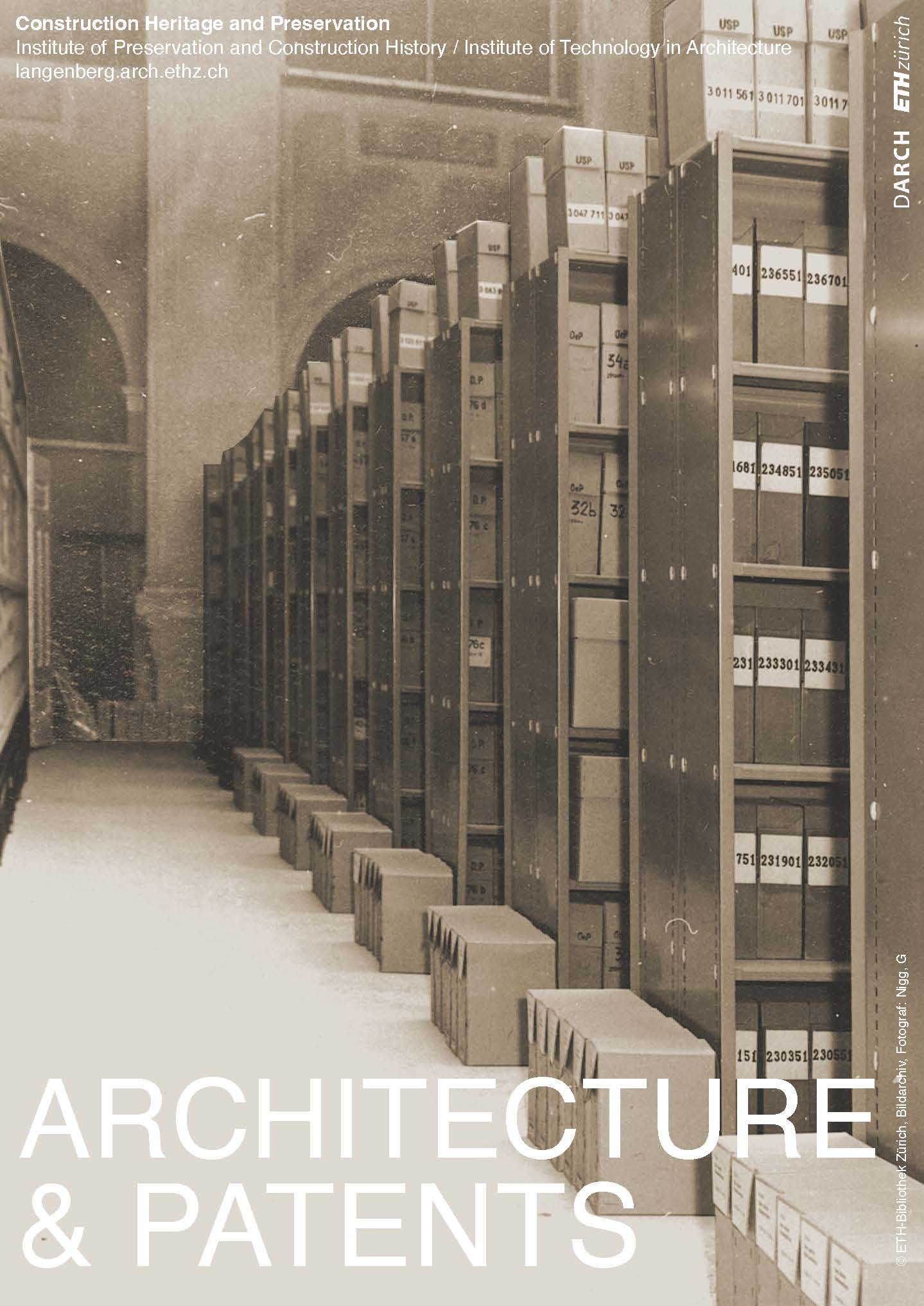
gefördert durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF)
Projektantrag und -leitung: Prof. Dr. Silke Langenberg und PD Dr. Robin Rehm
Co-Leitung und Kontakt: Dr. Sarah M. Schlachetzki
Um 1800 beginnt die Architektur aufgrund der Erfindung neuartiger Materialien, Konstruktionen und Maschinen einen neuen Bezug zur Tradition einzunehmen. Parallel dazu tritt das Patent auf den Plan. Mittels der Patente wird bautechnische Innovation, initiiert von den Wirtschaftsministerien der Länder, nun rechtlich beglaubigt. Im Bereich der Architektur trägt das Patent wesentlich dazu bei, technische Neuerungen auszudifferenzieren. Zudem übernimmt es die Rolle eines strategischen Instruments: Es reguliert produktive Effizienz, ökonomische Massnahmen und politische Machtverhältnisse zwischen Institutionen und Einzelpersonen.
Das SNF-Projekt «Architektur & Patent» untersucht das Patent am Beispiel der Bauten des ETH Bereichs in Zürich und Lausanne, den Standorten des Paul Scherrer Instituts sowie der EMPA von 1855 bis heute. Obgleich aus den innovativen, technischen und kreativen Belangen der Architektur kaum wegzudenken, ist das Architekturpatent nach wie vor wenig erforscht. Ausgegangen wird von dem Standpunkt, dass das Patent eine Vermittlerrolle bei der Umwandlung der sich im 19. Jahrhundert in historischen Baustilen legitimierenden Architektur hin zu ihrer Herleitung aus funktionsorientierten Baukonstruktionen in der Moderne übernimmt. Aus den Beziehungen, die bei solchen Prozessen entstehen, ergibt sich die im Projekt zu verfolgende Hauptfrage nach der Rolle des Patents bei der Entwicklung und Distribution technischer Erfindungen auf Ebene der Architektur.
Die Gebäude des ETH-Bereichs sind als Untersuchungsgegenstand für das Projekt besonders geeignet. Es handelt sich bei ihnen um ein sich über 150 Jahre hinweg entwickelndes Ensemble, das ökonomisch und politisch unter weitgehend homogenen Verhältnissen entstand. Der Gebäudebestand der ETH weist sich durch ein technisch und baukünstlerisch hohes Niveau aus. Mit Gottfried Sempers Polytechnikum beispielsweise und dem Rolex Learning Center von SANAA befinden sich darunter auch architektonische Wahrzeichen ihrer Zeit. Schliesslich erhebt die ETH den Anspruch, mit ihren Gebäuden Innovation und Technologieentwicklung zu repräsentieren. Dieser Programmatik geht das Projekt anhand von grundlegenden Patentanalysen nach.
Das Polytechnikum als Bauplatz 1880–1940
Dr. Sarah M. Schlachetzki
Vom Halbfabrikat zum Fertigbauteil 1930–1960
Nina Irmert
Struktur und Prozess 1960–1980
Tiago Matthes
«Open as a Matter of Principle». 2021
«Das Patent als Akteur technischer Innovationen. Hochschularchitektur der 1960er und 1970er Jahre». 2021
Designpatente der Moderne. 1840–1970. 2019
Bauten der Boomjahre. 2011
System & Serie. Systembau in der Schweiz – Geschichte und Erhaltung. 2022